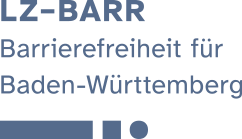anatom5 in Zahlen – Digitale Barrierefreiheit seit 2003
2003 – Der Anfang: Eine Reise durch den Wandel
Als wir 2003 anatom5 gegründet haben, stand digitale Barrierefreiheit kaum auf der Agenda – weder bei Agenturen noch bei Auftraggeber*innen. Für uns war sie trotzdem von Anfang an mehr als ein nettes Extra: Sie war das Fundament unserer Arbeit.
Seitdem begleiten wir eine Branche, die sich permanent neu erfindet. Die Liste der disruptiven Technologien ist lang: Vom Aussterben von Flash über den Aufstieg von HTML5, CSS3 und Responsive Webdesign, vom Siegeszug der Smartphones bis hin zu Smart Cities und dem Internet der Dinge. Wir haben gesehen, wie Plattformen kamen und gingen, wie neue Standards entstanden – und wie das, was heute selbstverständlich scheint, damals oft als „zu früh“ galt.
Was uns dabei immer geleitet hat: Der Wunsch, Technologie für alle zugänglich zu machen. Nicht jeder Hype ist ein Fortschritt – und nicht jede neue Idee ist automatisch inklusiv. Deshalb haben wir Trends nie blind verfolgt, sondern kritisch begleitet und mitgestaltet.
Heute, über 20 Jahre später, beginnt ein neues Kapitel: Künstliche Intelligenz und Automatisierung verändern gerade grundlegend, wie digitale Inhalte entstehen, geprüft und genutzt werden. Auch in der Barrierefreiheit eröffnen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten – und neue Herausforderungen. Unsere Reise ist damit längst nicht zu Ende. Im Gegenteil: Sie geht jetzt erst richtig weiter.
2002/2003 – Online-Druckereien verändern den Markt
Noch bevor anatom5 offiziell gegründet wurde, kündigte sich bereits ein Umbruch in der Druckbranche an: Online-Druckereien tauchten auf und brachten frischen Wind in einen lange unveränderten Markt. Anfangs belächelt – wegen begrenzter Produktauswahl und Qualitätsproblemen – entwickelten sich diese Anbieter dank automatisierter Prozesse, klarer Standards und günstiger Preise rasch zu einer echten Alternative.
Für viele klassische Hausdruckereien war das ein harter Schlag. Sie konnten mit der Effizienz und Skalierbarkeit der Online-Druckportale oft nicht mithalten. Heute überleben kleine Druckereien meist nur noch als Spezialisten für beratungsintensive oder individuelle Projekte.
Für uns als Agentur – und für unsere Kund*innen – war das ein echter Gewinn: Mehr Auswahl, niedrigere Kosten und schnellere Abwicklung. Der Wandel im Druckmarkt ist ein frühes Beispiel dafür, wie digitale Prozesse ganze Branchen umkrempeln – und wie wichtig es ist, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und zu nutzen.
2004 – Flickr & Creative Commons
Die Foto-Plattform Flickr geht online und verändert das Teilen und Nutzen von Bildern grundlegend. Creative Commons setzt neue Standards für die rechtssichere Nutzung von Inhalten. Beide Entwicklungen machen Webgestaltung zugänglicher und rechtlich klarer – auch ein Vorteil für barrierefreie Angebote.
2004/2005 – Blogging & Social Media: Der große Umbruch
Weblogs gab es zwar schon vor 2004, doch erst in diesen Jahren erreichte das Bloggen den Mainstream. Plötzlich konnte jede*r Inhalte veröffentlichen, Meinungen teilen, Themen setzen – ganz ohne Verlag oder Redaktion. Das Internet wurde persönlicher, diverser und zugänglicher. Auch wir bei anatom5 haben früh erkannt, welche Kraft in dieser offenen Kommunikationsform steckt.
Doch die digitale Öffentlichkeit veränderte sich schnell. Dienste wie Facebook, Twitter, Tumblr oder Pinterest führten das Micro-Blogging ein und machten Inhalte noch kurzlebiger – und oft weniger frei zugänglich. Was zuvor auf offenen Plattformen und eigenen Domains stattfand, verlagerte sich zunehmend in sogenannte „Walled Gardens“ – geschlossene Ökosysteme mit eigenen Regeln.
Auch hier erleben wir ein ständiges Kommen und Gehen: MySpace ist Geschichte, Google Plus gescheitert. Doch neue Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat oder BeReal stehen längst bereit. Die Social-Media-Welt ist fragmentierter denn je – und nicht jede Zielgruppe findet sich auf jeder Plattform wieder.
Unser Fazit: Auch im Social Web gilt das Prinzip der digitalen Barrierefreiheit. Nur wer Inhalte verständlich, zugänglich und plattformübergreifend denkt, erreicht wirklich alle – unabhängig von Gerät, Kanal oder Trend.
2005 – Fotolia & Google Maps
Mit Fotolia wird eine der ersten großen Microstock-Bilddatenbanken populär. Gleichzeitig geht Google Maps an den Start – ein Gamechanger für Location-basierte Services. Standort- und Routeninformationen bzw. mobile Navigation werden auch für blinde und sehbehinderte Menschen insbesondere durch Sprachsteuerung und Sprachausgabe zunehmend digital nutzbar.
2007 – Das iPhone verändert alles
Als Apple 2007 das erste iPhone vorstellt, beginnt eine neue Ära: Touchscreens, Apps und das mobile Internet erreichen den Massenmarkt. Was heute selbstverständlich ist, war damals eine Revolution – und für viele zunächst ein Rätsel, vor allem im Kontext von Barrierefreiheit.
Wie sollten Menschen mit motorischen oder visuellen Einschränkungen ein Gerät bedienen, das komplett auf visuelle Touch-Eingaben setzte? Die Skepsis war groß – auch bei uns. Doch die Zeit hat gezeigt, welches Potenzial in dieser Technologie steckt.
Heute sind Smartphones und Tablets zentraler Bestandteil digitaler Inklusion – vorausgesetzt, die eingesetzten Apps und Webanwendungen sind barrierefrei gestaltet. Betriebssysteme wie iOS und Android haben frühzeitig leistungsfähige Bedienungshilfen integriert: VoiceOver, TalkBack, Sprachsteuerung, Lupenfunktionen, haptisches Feedback, Touchgesten und anpassbare Kontraste sind längst Standard. Auch assistive Apps – vom Screenreader bis zur Gebärdensprach-Erkennung – haben mobile Geräte zu echten Alltagshelfern gemacht.
2008 – App-Stores öffnen
Mit dem Start des iTunes App Store 2008 beginnt ein globaler App-Boom. Plötzlich will jeder eine eigene App – ganz gleich ob Unternehmen, Medienhaus oder Kommune. Anfangs waren native Apps in Sachen Barrierefreiheit jedoch problematisch: Viele der frühen Frameworks boten kaum Möglichkeiten zur Zugänglichkeitsoptimierung, und etablierte Standards wie WCAG fanden in der App-Entwicklung wenig Beachtung.
Das hat sich grundlegend geändert. Heute können native Apps – wenn richtig umgesetzt – genauso barrierefrei sein wie moderne Webseiten. Betriebssysteme wie iOS und Android bieten umfassende Accessibility-APIs, und Frameworks wie Flutter, React Native oder SwiftUI bringen Accessibility-Features im Prinzip längst mit. Dennoch: Der Einstieg bleibt technisch anspruchsvoll und eine durchgängige Umsetzung erfordert spezifisches Know-how. Parallel dazu gewinnen HTML-basierte Web-Apps wieder an Bedeutung – auch, weil sie plattformunabhängig und leichter wartbar vereinbar sind. Für die digitale Barrierefreiheit ist das bis heute wichtig.
2010er – Responsive Webdesign und neue Standards
Mit dem wachsenden Geräte-Wildwuchs – vom Smartphone bis zum Smart-TV – wird eine zentrale Herausforderung immer drängender: Wie lassen sich Webseiten gestalten, die überall gut funktionieren? Die Antwort: Responsive Webdesign. Ab 2010 setzt sich dieses Gestaltungskonzept flächendeckend durch.
Für anatom5 war das nichts Neues – wir predigten geräteunabhängige Webentwicklung und Progressive Enhancement schon lange davor. Doch mit Responsive Design, HTML5, CSS3 und modernem JavaScript erhalten wir endlich die Werkzeuge, um diese Prinzipien systematisch umzusetzen. Webinhalte passen sich nun dynamisch an Bildschirmgrößen an, was nicht nur benutzerfreundlich ist, sondern auch der Barrierefreiheit zugutekommt.
2013 – Google Glass & Wearables
Mitte 2013 erscheint im Fachmagazin Screenguide ein Artikel von uns, in dem wir der damals viel gehypten Google Glass für den Massenmarkt einen Flop prophezeien – eine These, die sich bestätigt hat. Und dennoch: Die Idee, digitale Informationen direkt im Sichtfeld zu platzieren, war ihrer Zeit voraus. Und sie bleibt ein spannendes Thema – nicht nur für Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigung.
Wearables – also Smartwatches, Fitness-Tracker oder Sensorik-gestützte Kleidung – haben sich zwar technisch rasant weiterentwickelt, aber im Alltag sind vor allem Letztere nicht angekommen. Neben Smartwatches und Fitness-Trackern haben sich Wearables als allgegenwärtiges Technikgut in Form von Kleidung oder Brillen bis heute nicht durchgesetzt – auch weil Datenschutz, Bedienbarkeit und echter Mehrwert nicht überzeugen. Für die digitale Barrierefreiheit sind sie dennoch ein spannendes Feld, das wir auch weiterhin genau beobachten.
2014–2017 – Digitale Transformation
Zwischen 2014 und 2017 beginnt ein tiefgreifender Wandel: Die digitale Transformation wird spürbar – in Organisationen, Unternehmen, Behörden. Neue Tools, mobile Strategien, agile Prozesse und Cloud-Architekturen krempeln den Alltag um. Begriffe wie Mobile First, SaaS, Design Thinking und Plattformökonomie setzen sich durch – mit direkten Auswirkungen auf digitale Projekte. Mit dieser Dynamik wächst auch das Bewusstsein für digitale Barrierefreiheit: Sie ist längst nicht mehr nur „Nice to have“, sondern rückt ins Zentrum von UX, Usability und gesetzlicher Verantwortung. Besonders wichtig: Die EU-Richtlinie 2016/2102, die barrierefreie Webangebote für öffentliche Stellen in ganz Europa verbindlich macht – ein Meilenstein für Inklusion im digitalen Raum.
2018 – IoT & Smart Cities
Internet of Things (IoT) – ein Begriff, der schon lange existiert (Stichwort: Ubiquitous Computing), erreicht nun den kommunalen Raum. Materielle und virtuelle Gegenstände kommunizieren miteinander, um Lebens- und Stadtraum smarter, effizienter – und idealerweise barriereärmer – zu gestalten. Für uns bedeutet das: Neue Chancen, digitale Barrierefreiheit konkret und ortsbezogen umzusetzen. In der Stadt Xanten entsteht mit unserer Hilfe eine barrierefreie Kurpark-App auf Basis von Beacon-Technologie – ergänzt durch Geolokalisierung, RFID und adaptive Inhalte. Ein Beispiel dafür, wie Technik im öffentlichen Raum nicht nur smarter, sondern auch inklusiver werden kann.
2022 – Künstliche Intelligenz
Seit Ende 2022 erleben wir den rasanten Einzug von KI-Technologien in nahezu alle digitalen Bereiche. Sprachmodelle wie GPT eröffnen auch in der digitalen Barrierefreiheit spannende Möglichkeiten – vorausgesetzt, man setzt sie mit Augenmaß ein. Bei anatom5 nutzen wir KI gezielt als Werkzeug – nicht als Allheilmittel. Zum Beispiel:
- zur Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten in Einfacher Sprache,
- zur Vorproduktion von Alternativtexten als Ausgangspunkt für die redaktionelle Prüfung,
- zur Analyse und Vorbewertung von Barrierefreiheitskriterien, etwa im Rahmen von Audits.
Dabei beobachten wir den Hype sehr genau – und bewerten viele KI-Versprechen mit einer gesunden Portion Skepsis. Accessibility-Overlays, vollautomatisierte Tests oder generierte Barrierefreiheit auf Knopfdruck mögen gut klingen, lösen aber in der Praxis nicht die echten Herausforderungen. Digitale Teilhabe braucht mehr als technische Tools – sie braucht Expertise, Empathie und den Willen zur Inklusion.
Heute – 22 Jahre anatom5
Was bleibt? Technik kommt (und geht auch manchmal wieder) – aber unser Anspruch an digitale Teilhabe bleibt bestehen. Mit konsequent barrierefreien Lösungen und einem Blick für technologische Entwicklungen begleiten wir Unternehmen, Kommunen und Organisationen in eine inklusive digitale Zukunft.