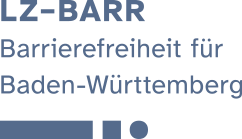Beratung mit Plan: Umsetzung des BFSG

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verpflichtet viele Unternehmen in Deutschland seit dem 28. Juni 2025, ihre Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Auch wenn es seit dem DSGVO-Hype im Jahr 2018 keine vergleichbar tiefgreifende Veränderung durch die Gesetzgebung gegeben hat, viele Unternehmen, die vom BFSG betroffen sind, haben den Termin verpasst oder mit der Planung und Umsetzung gerade erst begonnen. Aktionismus hilft aber auch jetzt nicht. Es braucht zunächst eine Roadmap, um die Anforderungen des BFSG überhaupt verstehen, geschweige denn umsetzen zu können.
Besonders im Fokus stehen vertriebsorientierte Websites, Produkt und Dienstleistungsbezogene Apps sowie Online-Shops und weitere Schnittstellen, die in diesem Kontext eine Rolle spielen, zum Beispiel technischer Kundensupport, E-Mail-Kommunikation im Zuge einer Vertragsanbahnung oder eines Vertragsabschlusses oder PDF-Dokumente (zum Beispiel AGB oder die Widerrufsbelehrung, aber auch Produktbeschreibungen) – aber dazu später mehr.
Wer sich also mit der Umsetzung des BFSG bis jetzt noch nicht befasst hat, stellt sich spätestens jetzt bei der Lektüre dieses Textes die Frage: Was ist konkret zu tun? Wer ist betroffen? Und wie gelingt die Umsetzung praxisnah, wirtschaftlich sinnvoll und vor allem rechtssicher? Denn das BFSG ist ein Verbraucherschutzgesetz und auch im Zusammenhang mit dem UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) relevant.
Klar ist: Ohne Plan geht es nicht. Und ohne Beratung wird es schnell kompliziert. Dieser Beitrag zeigt, wie ein strategischer Umsetzungsplan aussehen kann – und welche Rolle externe Expertise dabei spielen sollte.
Schon mal als Tipp vorneweg: sogenannte Accessibility-Plugins sind keine Lösung.
Klären, ob das BFSG greift
Am Anfang jeder Umsetzung steht die zentrale Frage: Fällt mein Unternehmen unter die Regelungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG)? Diese Prüfung ist der Ausgangspunkt für alle weiteren Maßnahmen. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen Produkten und Dienstleistungen – und berücksichtigt auch die Größe des Unternehmens.
Bei Produkten, etwa Geldautomaten, Fahrkartenautomaten, E-Readern oder Hardware mit digitalen Benutzeroberflächen, gelten die Anforderungen grundsätzlich für alle Unternehmen, unabhängig von deren Größe.
Anders sieht es bei Dienstleistungen aus – dazu zählen unter anderem digitale Verkaufs- und Buchungssysteme, Bankdienstleistungen, Telekommunikationsdienste sowie andere digitale Angebote, wie sie im BFSG definiert sind. Auch der große Bereich E-Commerce fällt darunter. Hier gelten Einschränkungen: Unternehmen, die weniger als zehn Personen beschäftigen und deren Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme zwei Millionen Euro nicht übersteigt, sind von der Pflicht zur barrierefreien Gestaltung von Dienstleistungen ausgenommen – das betrifft dann zum Beispiel Websites, mobile Apps, Online-Shops, Buchungssysteme oder elektronische Kommunikationsdienste. Trotzdem kann es auch für Kleinunternehmen sinnvoll sein, das BFSG freiwillig umzusetzen – insbesondere in Wachstumsbranchen, in denen die genannte Schwelle vielleicht schnell erreicht ist. Denn ad hoc lässt sich das BFSG dann nicht mal eben so umsetzen.
Ein genauer Blick auf die eigenen Produkte, Dienstleistungen und rechtlichen Rollen (Anbieter, Hersteller, Importeur, Händler) ist daher unerlässlich. Unternehmen sollten prüfen, welche Angebote sie ab dem 28. Juni 2025 neu in Verkehr bringen oder wesentlich überarbeiten, denn genau ab diesem Zeitpunkt gelten die BFSG-Anforderungen.
Zudem betreffen die gesetzlichen Vorgaben nicht nur Produkte selbst, sondern auch begleitende Dienstleistungen: technischer Support, Produkt-Dokumentationen, Schulungsmaterial oder der Zugang zur Benutzeroberfläche von Produkten. Auch Tochtergesellschaften, Zulieferer oder Lizenzgeber sollten bei der Prüfung nicht vergessen werden – denn Barrierefreiheit endet nicht an der eigenen Bürotür.
Welche Systeme und Prozesse sind vom BFSG betroffen?
Wer seine Pflichten im Rahmen des BFSG kennt, sollte im nächsten Schritt nicht mit aktionistischen Einzelmaßnahmen beginnen – ansonsten landet man schnell bei „Pseudo-Experten“ oder fällt auf die Werbeversprechen von Accessibility-Overlay-Anbietern rein. Zunächst stellt sich die zentrale Frage: Wo steht Ihre Organisation aktuell in Sachen Barrierefreiheit – fachlich, technisch und organisatorisch?
Eine systematische Bestandsaufnahme hilft Ihnen, Lücken im bestehenden System zu identifizieren, vielleicht bereits funktionierende Lösungen sichtbar zu machen und Ressourcen gezielt einzusetzen. Eine Bestandsaufnahme ist deutlich mehr als ein oberflächlicher und kostenloser BFSG-Schnellcheck, wie er oft in Lockangeboten zu finden ist. Digitale Barrierefreiheit betrifft zahlreiche Bereiche im Unternehmen: von der IT über die Redaktion bis hin zum Kundendienst, der Rechtsabteilung bis hin zum Management (Human Ressource, Beschaffung, Produktentwicklung, etc).
Der erste Schritt ist die gründliche Analyse der digitalen Infrastruktur. Welche Websites, Anwendungen, mobilen Apps, E-Commerce-Plattformen oder Kundenportale betreiben wir? Welche davon sind Eigenentwicklungen, welche basieren auf Drittanbieterlösungen? Wo gibt es automatisierte Schnittstellen, etwa zu Zahlungsdiensten, Buchungssystemen oder Helpdesks?
Mindestens ebenso wichtig ist der Blick auf die organisatorischen und redaktionellen Abläufe. Wer erstellt und pflegt die Inhalte? Gibt es redaktionelle Leitlinien für barrierefreie Gestaltung – etwa für Alt-Texte, Untertitel oder die Erstellung zugänglicher PDF-Dokumente? Sind interne Workflows so aufgestellt, dass Barrierefreiheit mitgedacht wird – zum Beispiel beim Corporate Design?
Auch die technologischen Rahmenbedingungen müssen kritisch geprüft werden. Ein modernes Content-Management-System (CMS) kann zwar die technischen Voraussetzungen für barrierefreie Inhalte schaffen – doch nur, wenn es entsprechend konfiguriert ist, barrierefreie Templates verwendet werden und die Mitarbeitenden das nötige Know-how mitbringen. Umgekehrt können ungeeignete Systeme, unflexible Schnittstellen oder nicht barrierefreie Dritttools und Plugins die Umsetzung erheblich erschweren oder unmöglich machen.
Schließlich ist die Frage nach der Verankerung im Unternehmen entscheidend. Gibt es klare Verantwortlichkeiten für das Thema Barrierefreiheit? Wird es in Projektentscheidungen frühzeitig berücksichtigt? Sind Kompetenzen intern vorhanden oder müssen sie extern ergänzt werden?
Eine solche Bestandsaufnahme schafft die Grundlage für einen strukturierten, realistischen Umsetzungsplan. Wer den eigenen Status quo kennt, kann gezielt priorisieren, Maßnahmen aufeinander aufbauen und Synergien nutzen – statt Zeit und Ressourcen im Aktionismus zu verlieren.
Die richtigen Menschen einbeziehen
Die Umsetzung des BFSG (also der Barrierefreiheit) ist Teamarbeit – und genau das macht die Planung und Umsetzung oft so komplex. In vielen Unternehmen fehlt bislang das nötige Know-how oder es ist auf mehrere Abteilungen verteilt: ein wenig bei der IT, ein bisschen im UX-Team, ein klein wenig in der Online-Redaktion und vereinzelt im Kundenservice oder in der Rechtsabteilung. Selten gibt es eine zentrale Stelle, die das Thema strategisch zusammenführt. Deshalb ist es sinnvoll, im Rahmen der Bestandsaufnahme auch die internen Zuständigkeiten zu klären: Wer trägt aktuell Verantwortung? Wer bringt bereits Fachwissen mit? Wo bestehen Lücken? Und wer müsste geschult oder stärker eingebunden werden, um die Anforderungen des BFSG wirksam umzusetzen?
Mit Reifegradanalyse zur Umsetzung des BFSG
Ein sogenanntes Maturity Model – also eine Reifegradanalyse – kann dabei helfen, den eigenen Standpunkt systematisch zu erfassen. Es zeigt auf, ob Barrierefreiheit bereits etabliert ist, nur punktuell berücksichtigt wird oder bisher kaum eine Rolle spielt. Daraus lassen sich konkrete Entwicklungsschritte ableiten – vom Aufbau interner Kompetenz über die Verankerung in Prozessen bis hin zur strategischen Integration ins Qualitätsmanagement.
Wichtig ist, Barrierefreiheit nicht als technisches Einzelprojekt zu betrachten, sondern als dauerhaften Bestandteil digitaler Qualitätssicherung und Organisationsentwicklung. Das erfordert häufig einen kulturellen Wandel: weg von kurzfristigen Reparaturen hin zu nachhaltiger Planung und mitgedachter Zugänglichkeit. Dieser Wandel geschieht nicht über Nacht – aber mit klarer Zielsetzung, realistischen Etappen und kompetenter Unterstützung (zum Beispiel mithilfe externer Beratung und Moderation) ist er machbar – und notwendig.
Ein hilfreiches Werkzeug für diesen Schritt ist ein sogenanntes Maturity Model – also eine Reifegradanalyse, mit der sich der aktuelle Stand der Organisation im Umgang mit Barrierefreiheit systematisch erfassen lässt. Das international etablierte WCAG Accessibility Maturity Model, entwickelt von der W3C Accessibility Guidelines Working Group, bietet hierfür eine praxisnahe Grundlage. Es beschreibt fünf Entwicklungsstufen – von ad-hoc und reaktiv bis hin zu strategisch integriert und organisationsweit verankert.
anatom5 in Zahlen
- 200 BITV- und BFSG-Audits im Rahmen externer Mandate
- 22 Jahre Erfahrung im Bereich der digitalen Barrierefreiheit
- 3000 Stunden Accessibility-Beratung – Projekt begleitend und ad hoc
Externe Beratung gezielt einsetzen
Nicht nur in der Startphase oder bei komplexen Anforderungen kann die Unterstützung durch eine externe Fachberatung sinnvoll sein. Und eine externe Beratung zur Umsetzung des BFSG muss auch nicht nur ein einmaliger Barrierefreiheitstest sein. Sie können die Expertise von spezialisierten Unternehmen, wie anatom5 als kontinuierliches Instrument einsetzen, um digitale Barrierefreiheit fachlich fundiert, fortlaufend und praxisnah umzusetzen.
Externe Beratung unterstützt Unternehmen dabei, die Anforderungen des BFSG zu verstehen, geeignete Maßnahmen zu planen und interne Strukturen zu stärken – von der ersten Standortbestimmung bis zur langfristigen Pflege und Weiterentwicklung.
Bereits in der frühen Phase eines Projekts hilft Beratung, die relevanten Anforderungen einzugrenzen und sie auf das konkrete Geschäftsmodell zu übertragen. Welche Dienstleistungen fallen unter das BFSG? Welche Teile der EN 301 549 oder ergänzender Standards wie PDF/UA sind verbindlich, welche empfehlenswert? Was ist realistisch umsetzbar – und in welchem Zeitrahmen? Und wo muss man ansetzen?
Ein sinnvoller Einstieg kann zum Beispiel eine Reifegradanalyse sein (kann man natürlich auch in Eigenregie machen). Eine Reifegradanalyse macht sichtbar, wie weit Barrierefreiheit im eigenen Unternehmen bereits verankert ist, welche Prozesse fehlen oder verbessert werden können – und wo gezielte Schulungen nötig sind. Solche Schulungen können sich an unterschiedliche Zielgruppen richten: zum Beispiel Design- und UX-Teams, die Frontend-Entwicklung, Online-Redaktionen oder die Management-Ebene.
Darüber hinaus bietet externe Beratung eine fachliche Begleitung bei der Entwicklung, Prüfung und Dokumentation konkreter Maßnahmen. Dazu gehören beispielsweise technische Audits (Barriere-Check Pro oder BITV-Test) , Prüfberichte und Handlungsempfehlungen – ebenso wie die Bewertung einzelner Komponenten oder Features im laufenden Betrieb. In iterativen Prozessen kann Beratung helfen, neue Anforderungen kontinuierlich zu integrieren – etwa bei der Einführung neuer Features und Funktionen, wie zum Beispiel einem Chatbot, einem neuen Buchungssystems, bei CMS-Updates oder bei der Erweiterung bestehender Module.
Nicht zuletzt spielt Beratung auch bei der ständigen Aktualisierung der Barrierefreiheitserklärung eine Rolle. Da sich Angebote, Inhalte und rechtliche Rahmenbedingungen regelmäßig ändern, muss auch die Erklärung fortlaufend überprüft und angepasst werden. Das setzt voraus, dass Unternehmen jederzeit wissen, wie barrierefrei ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen aktuell tatsächlich sind. Das kann man im Rahmen einer Selbstbewertung machen, oder externen Rat einholen – was vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es sich bei dem BFSG um ein Verbraucherschutzgesetz handelt und auch das UWG mit reinspielt, die bessere Lösung sein dürft.
Fachlich fundierte Beratung trägt dazu bei, Barrierefreiheit als Bestandteil digitaler Qualitätssicherung zu etablieren – nicht nur zu Projektbeginn, sondern über den gesamten Lebenszyklus digitaler Anwendungen hinweg. Sie verschafft allen Beteiligten Sicherheit, reduziert Risiken und ermöglicht fundierte Entscheidungen für notwendige Maßnahmen.
Tipp: Auch Klein- und Kleinstunternehmen profitieren von Beratungsangeboten. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit etwa bietet kostenlose Unterstützung für Unternehmen mit begrenzten Ressourcen.
Darüber hinaus gibt es spezialisierte Agenturen, die bei technischen Analysen, Projektplanung, Audits oder Schulungen begleiten können – so wie wir bei anatom5 es seit vielen Jahren tun.
BFSG – Dokumentation und Monitoring
Die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) enden nicht mit der Umsetzung einzelner Maßnahmen. Unternehmen sind verpflichtet, die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen nicht nur umzusetzen, sondern auch nachvollziehbar zu dokumentieren – und dauerhaft sicherzustellen, dass ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen barrierefrei bleiben. Dazu gehört eine transparente Kommunikation gegenüber Nutzer:innen, etwa über die gesetzlich vorgeschriebene Barrierefreiheitserklärung. Gleichzeitig ist auch eine interne Dokumentation der Maßnahmen und Prüfprozesse erforderlich, um im Fall von Anfragen durch Marktüberwachungsbehörden nachweisen zu können, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen nachkommt.
Juristische Begleitung einbeziehen
Bei der Erstellung der Barrierefreiheitserklärung im Sinne des BFSG ist besondere Sorgfalt geboten. Anders als bei der eher informativen „Erklärung zur Barrierefreiheit“ nach BITV, handelt es sich bei der Barrierefreiheitserklärung um ein rechtsverbindliches Dokument, das marktaufsichtsrechtlich und unter Umständen auch wettbewerbsrechtlich relevant ist. Unternehmen, die in ihrer Erklärung offenlegen, dass wesentliche Funktionen nicht barrierefrei gestaltet sind, setzen sich potenziell dem Risiko von Verbraucherbeschwerden, Abmahnungen oder sogar Unterlassungsklagen nach dem UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) aus – insbesondere dann, wenn keine klaren Nachweise über bereits eingeleitete Maßnahmen oder realistische Fristen vorliegen.
Es ist daher empfehlenswert, die Barrierefreiheitserklärung nicht ohne Rechtsabteilung oder externer juristischen Beratung zu formulieren. Eine rechtliche Prüfung der Inhalte – insbesondere bei komplexen oder noch nicht vollständig erfüllten Anforderungen – kann helfen, Formulierungen abzustimmen, Risiken zu minimieren und gleichzeitig der Pflicht zur Transparenz gerecht zu werden. Auch der Umgang mit Rückmeldungen über das in der Erklärung genannte Feedbackformular sollte im Unternehmen rechtlich begleitet und organisatorisch klar geregelt sein.
BFSG – wenn man nichts tut?
Wer gegen das BFSG verstößt, muss mit spürbaren Konsequenzen rechnen. Die Bußgelder können bis zu 100.000 Euro betragen – und zusätzlich drohen Abmahnungen durch Wettbewerber oder Verbände. Abgesehen davon ist das Thema Barrierefreiheit zunehmend öffentlich sichtbar. Schlechte Presse oder negative Nutzerbewertungen können den Imageschaden deutlich vergrößern. Es ist daher nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, sich mit der Umsetzung des BFSG ernsthaft auseinanderzusetzen – und dabei auf nachhaltige Lösungen zu setzen, statt auf „Feigenblätter“ wie Accessibility-Overlays.
Fazit: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist rechtskräftig – und es wird durchgesetzt werden. Viele Unternehmen haben den Termin 28. Juni 2025 aus den Augen verloren oder die Komplexität unterschätzt. Wer jetzt noch nicht begonnen hat, wird unter Zeitdruck geraten – aber übereilte Einzelmaßnahmen sind keine Lösung.
Barrierefreiheit lässt sich nicht nachträglich über ein digitales Produkt legen. Sie muss geplant, überprüft, dokumentiert und dauerhaft verankert werden – technisch, redaktionell, organisatorisch und rechtlich. Dazu braucht es klare Zuständigkeiten, interne Kompetenzentwicklung und, wo nötig, gezielte externe Unterstützung.
Beratung ist kein Selbstzweck. Sie hilft, Anforderungen zu verstehen, Risiken realistisch einzuschätzen und Maßnahmen sinnvoll zu priorisieren. Das gilt für große Unternehmen ebenso wie für Kleinstbetriebe. Und es gilt nicht nur jetzt, sondern auch nach dem 28. Juni 2025 – bei jedem Update, jedem Relaunch und jeder Weiterentwicklung. Wer digitale Barrierefreiheit ernst nimmt, handelt nicht nur gesetzeskonform, sondern verbessert Qualität, Kundenerlebnis und Zugänglichkeit für alle.
Ausgewählte Kundestimme
Lesen Sie auch unsere anderen Kundenstimmen, die zeigen, wie sehr unsere Expertise und unser Engagement im Bereich der digitalen Barrierefreiheit geschätzt werden.
-
Vodafone – Umsetzung der Anforderungen des BFSG
Seit Ende 2023 steht anatom5 unseren internen Fachbereichen mit kompetenter Beratung rund um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) zur Seite. Im Laufe des Projekts wurden mehrere hundert Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Bereichen – von UX-Design, Online-Redaktion und Qualitätssicherung bis hin zu Webentwicklung – geschult und praxisnah sensibilisiert. Besonders hervorzuheben ist das modulare Schulungskonzept, das gezielt auf die Anforderungen der jeweiligen Gewerke einging und es uns ermöglichte, nachhaltiges Wissen im Unternehmen zu verankern. Durch die enge Zusammenarbeit konnten wir unsere digitalen Angebote gezielt weiterentwickeln und barrierefreier gestalten. Besonders hilfreich waren neben wiederkehrenden Accessibility Audits die zweiwöchentlich stattfindende Accessibility-Sprechstunden, in denen wir sehr viele verschiedene Fragestellungen zur konkreten Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit bei Vodafone klären konnten. Wir danken anatom5 für die professionelle Unterstützung und das große Engagement in einem komplexen, internationalen Projektumfeld.“ Daniela Palm (Programm Managerin BFSG Vodafone GmbH)