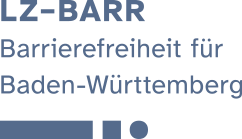Universal Design – Gestaltung ohne Barrieren

Wenn von digitaler Barrierefreiheit die Rede ist, insbesondere im Kontext OZG, BITV und BFSG, denken die meisten an digitale Schnittstellen wie Websites oder Apps. Barrierefreiheit wird dann meist projektweise bedacht, also beim nächsten Relaunch oder beim nächsten PDF-Formular, das ggf. auch unter die BITV oder das BFSG fällt. Oft fällt dann auf, dass man bereits Altlasten mit sich herumträgt, die bei der Umsetzung von Barrierefreiheit nicht gerade förderlich sind. Mit Altlasten sind Corporate-Design-Vorgaben gemeint. Das Problem sind sehr oft vorhandene Farbspezifikationen und auf dieser Basis bereits umgesetzte Kommunikationsmaterialien. Je umfangreicher das Kommunikationsmaterial (Außenwerbung, Printwerbung, TV-Werbung, Online-Werbung, Direktwerbung, Event- & Messewerbung etc.) bereits ist, umso folgenschwerer ist eine Anpassung der Farbspezifikationen, die Barrierefreiheit bereits von Grund auf berücksichtigt. Das betrifft nicht nur Unternehmen, die unter das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz fallen, sondern auch die öffentliche Hand.
Das Thema Barrierefreiheit sollte also immer schon beim Corporate Design mit bedacht werden. Wer ein Corporate Design entwickelt oder weiterentwickelt und daraus Kommunikationslösungen ableitet, legt bereits den Grundstein für Zugänglichkeit im Internet. Leider finden die Disziplinen Corporate Design und Barrierefreiheit selten in den gleichen Köpfen statt. Barrierefreiheit ist wie gesagt meist eine nachgelagerte Fragestellung, wenn das Kind in Bezug auf die Corporate-Design-Farben bereits in den Brunnen gefallen ist.
Hier kommt universelles Design ins Spiel. Universelles Design ist ein durchgehendes Prinzip, bei dem jede Gestaltung von vornherein so angelegt ist, dass sie für möglichst viele Menschen funktioniert, insbesondere auch für Menschen mit einer Behinderung – und das fängt beim Corporate Design an. Im Zweifelsfall sollten Sie sich beim nächsten Corporate-Design-Relaunch einen externen Accessibility-Experten mit an Bord holen, der den Prozess von Anfang an begleitet. Denn langfristig ersparen Sie sich damit viel Ärger. Sprechen Sie uns gerne dazu an.
Aber was genau ist Universal Design?
Die Grundidee von Universal Design zielt darauf ab, Produkte, Umgebungen und Informationen so zu gestalten, dass sie entweder ohne Anpassung nutzbar sind oder sich durch Nutzerinnen und Nutzer individuell anpassen lassen. Das bezieht sich nicht nur auf Alltagsprodukte wie zum Beispiel eine Schere, die sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder ausgelegt ist. Das Prinzip lässt sich auch auf Kommunikationsmaterialien (insbesondere digitale Produkte) und eben das Corporate Design anwenden – das betrifft grundlegende Usability-Regeln ebenso wie Anforderungen, die sich aus der BITV oder dem BFSG ergeben. Dazu zählen zum Beispiel:
- Farben, Kontraste und Formen, die auch bei unterschiedlichen Sehbeeinträchtigungen erkennbar und unterscheidbar bleiben.
- Schriftgrößen, Strichstärken sowie Zeilen- und Zeichenabstände die nach DIN 1450 die Lesbarkeit von Texten verbessern.
- Zielgruppengerecht aufbereitete Informationen und didaktisch sinnvolle Strukturierung, die sowohl gedruckt als auch digital funktioniert (zum Beispiel als barrierefreies PDF) und das Verständnis sowie die Fehlertoleranz verbessern.
Gebrauchstauglichkeit und Lernförderlichkeit
DIN-Normen in Verbindung mit Kreativleistungen scheinen für viele Menschen zunächst abschreckend zu wirken. Dabei sind DIN-Normen oftmals hilfreiche Leitlinien, wenn es um ganz praktische Fragen wie zum Beispiel eine einheitliche Schreibweise von Telefonnummern geht. Auch im Bereich der barrierefreien Gestaltung gibt es DIN-Normen, die Orientierung geben. Zum Beispiel die DIN EN ISO 9241-11 als zentrale Norm für Usability (zu Deutsch etwas sperrig „Gebrauchstauglichkeit“).
Was ist die DIN EN ISO 9241-11?
Die Norm DIN EN ISO 9241-11 gehört in den großen Normenkomplex DIN EN ISO 9241 (Ergonomie der Mensch-System-Interaktion). Die DIN EN ISO 9241-11 ist ein spezifischer Teil dieser Normenreihe und trägt den Titel: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 11: Gebrauchstauglichkeit: Begriffe und Konzepte. Diese Norm beschreibt Gebrauchstauglichkeit als das Maß, in dem ein Produkt von bestimmten Nutzergruppen in einem bestimmten Nutzungskontext effektiv, effizient und zufriedenstellend genutzt werden kann. Das gilt nicht nur für Software, sondern auch für Medien wie Forschungsberichte, Lernunterlagen oder interaktive PDF-Formulare.
Die sieben Usability-Prinzipien – Aufgabenangemessenheit, Erwartungskonformität, Erlernbarkeit, Steuerbarkeit, Fehlertoleranz, Individualisierbarkeit und Selbstbeschreibungsfähigkeit – sind also eng mit den Prinzipien des Universal Design verbunden. Dazu gehören auch die didaktische Reduktion, also die Aufbereitung komplexer Inhalte in eine verständliche und lernförderliche Form, sowie eine robuste Gestaltung, also eine Gestaltung, die dafür sorgt, dass Inhalte auch unter ungünstigen Bedingungen wie schwacher Beleuchtung, kleinem Bildschirm oder eben auch mit einer Behinderung gut funktionieren.
Brücke zur digitalen Barrierefreiheit
Die Richtlinien für digitale Barrierefreiheit auf Grundlage der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) berücksichtigen zunächst einmal explizit keine Usability-Aspekte. Zitat:
There are many general usability guidelines that make content more usable by all people, including those with disabilities. However, in WCAG 2.0, we only include those guidelines that address problems particular to people with disabilities.
Gerade an dieser Stelle schlägt die BITV aber eine Brücke zwischen Accessibility und Usability: Nach § 3 Abs. 3 sind digitale Angebote nicht nur gemäß den europäischen Standards barrierefrei zu gestalten, sondern darüber hinaus nach dem Stand der Technik weiterzuführen, wenn bestimmte Nutzeranforderungen in den bestehenden Richtlinien für Barrierefreiheit noch nicht abgedeckt sind. Damit wird deutlich, dass gute Gebrauchstauglichkeit (Usability) und Barrierefreiheit (Accessibility) im Sinne eines Universal Design Hand in Hand gehen müssen.
Universal Design ist also untrennbar mit den Anforderungen der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0), der EN 301 549 und dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verbunden – vor allem, wenn man Barrierefreiheit nicht nur als lästige gesetzliche Verpflichtung, sondern als Grundprinzip einer inklusiven Gesellschaft versteht.
Barrierefreiheit fängt nicht erst auf einer Website an (schon gar nicht durch ein nachträglich über eine Zeile JavaScript implementiertes Accessibility-Overlay). Barrierefreiheit beginnt beim Corporate Design, in den ersten Kommunikationsmitteln und in der Art, wie Informationen aufbereitet werden. Ein Corporate Design, das Schriftgrößen, Kontraste und klare Strukturen vorgibt, erleichtert die Umsetzung der Anforderungen aus BITV und Barrierefreiheitsstärkungsgesetz erheblich. Das Gleiche gilt für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), das für digitale Verwaltungsleistungen ebenfalls die Grundregeln der Gebrauchstauglichkeit (Usability) und der Barrierefreiheit mit einfordert.
Universal Design als DNA
Unsere Spezialisierung auf digitale Barrierefreiheit prägt jede gestalterische Entscheidung – ob im Kommunikationsdesign, im Corporate Design oder in der Webentwicklung. Farben, Schriften und Gestaltungsrichtlinien eines Corporate Designs prägen nicht nur ein Logo oder eine Visitenkarte, sondern wirken sich auf alle späteren Anwendungen aus – von PowerPoint-Folien, die oft als PDF im Web veröffentlicht werden, bis hin zu Diagrammen in Berichten oder zur Gestaltung einer App. Werden im Corporate Design zum Beispiel zu helle Farben und Farbkombinationen definiert, kann das später zum Beispiel bei der Gestaltung von Balken- oder Kreisdiagrammen zu unlösbaren Kontrastproblemen führen. Ähnlich kritisch ist die Wahl von Schriftarten und Font-Varianten: Dünne Schriftschnitte wie „Light“ oder „Thin“ reduzieren die Lesbarkeit, extreme Fettschriften können für Menschen mit starker Sehbehinderung problematisch sein, und durchgängige Versalschreibweise kann nicht nur das Leseverständnis, sondern ggf. auch die Screenreader-Ausgabe negativ beeinflussen.
Designentscheidungen betreffen längst nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern in einer alternden Gesellschaft eine breite Nutzergruppe. Hinzu kommt, dass eine wachsende Zahl an Menschen mit Migrationshintergrund von klarer Typografie, einfacher Sprache und fehlertoleranten User-Interfaces profitiert. Corporate-Design-Entscheidungen legen also die Grundlagen für die Barrierefreiheit digitaler Inhalte und Anwendungen und gehen weit über die rein ästhetische Ebene hinaus. Entscheidend ist, die Gestaltung konsequent nutzerzentriert zu denken – und zwar mit Blick auf eine diverse Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen.