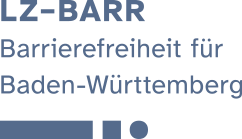Digitale Barrierefreiheit: Ein Menschenrecht mit starken Wurzeln
Digitale Barrierefreiheit ist kein "Nice-to-have" – sie ist ein Menschenrecht. Dieser Grundsatz zieht sich wie ein roter Faden durch die internationalen, europäischen und nationalen Rechtsgrundlagen. Wer sich mit digitalen Angeboten beschäftigt – sei es als Unternehmen oder öffentliche Stelle – sollte diese rechtlichen Zusammenhänge kennen. Denn sie zeigen: Barrierefreiheit ist nicht nur technische Pflicht, sondern auch gesellschaftlicher Auftrag.

1. Die UN-Ebene: Der Ursprung des Menschenrechts auf Barrierefreiheit
Auf internationaler Ebene ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) der Grundstein. Sie formuliert das Recht aller Menschen auf Gleichheit, Freiheit und Teilhabe – unabhängig von individuellen Voraussetzungen.
Daraus hervorgegangen ist die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die 2009 in Deutschland in Kraft trat. Sie betont explizit das Recht auf gleichberechtigten Zugang zu Information und Kommunikation – auch im digitalen Raum. Artikel 9 der UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, Barrieren aktiv abzubauen und den Zugang zu IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) sicherzustellen.
2. Die deutsche Ebene: Nationale Umsetzung der Konvention
In Deutschland wurde die UN-BRK durch mehrere gesetzgeberische Maßnahmen umgesetzt. Herzstück ist der Nationale Aktionsplan (NAP 2.0), der die politische Strategie zur Umsetzung der Konvention bündelt. Daraus ergeben sich konkrete gesetzliche Regelungen:
- Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) formuliert die allgemeinen Anforderungen an Barrierefreiheit und verpflichtet insbesondere staatliche Stellen zum Handeln.
- Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) konkretisiert die Anforderungen für Websites und mobile Anwendungen des öffentlichen Sektors.
- Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) nimmt ab 2025 auch viele privatwirtschaftliche Anbieter in die Pflicht – z. B. im E-Commerce, bei Selbstbedienungsterminals oder digitalen Dienstleistungen.
3. Die EU-Ebene: Gemeinsame Standards für Barrierefreiheit
Auch auf europäischer Ebene ist das Menschenrecht auf Barrierefreiheit verankert – unter anderem in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Darauf bauen mehrere wichtige Richtlinien auf, die alle EU-Mitgliedstaaten umsetzen müssen:
- Die Richtlinie (EU) 2016/2102 verpflichtet öffentliche Stellen zu barrierefreien Websites und mobilen Anwendungen. In Deutschland wurde sie durch die BITV umgesetzt.
- Die Norm EN 301 549 definiert technische Anforderungen für barrierefreie Informations- und Kommunikationstechnologie. Sie ist in vielen Vergabeverfahren und Ausschreibungen maßgeblich.
- Der European Accessibility Act (Richtlinie 2019/882) richtet sich an privatwirtschaftliche Anbieter und regelt den Zugang zu einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen – von Bankautomaten bis hin zu Online-Shops. Das BFSG ist die deutsche Umsetzung dieser Richtlinie.
Fazit: Drei Ebenen, ein Ziel
Internationale Menschenrechte, europäische Richtlinien und nationale Gesetze – alle verfolgen dasselbe Ziel: digitale Teilhabe für alle Menschen. Barrierefreiheit im digitalen Raum ist keine freiwillige Wohltat, sondern ein klar geregeltes Recht. Die gesetzlichen Grundlagen sind komplex, aber konsistent: Wer barrierefreie Angebote entwickelt, handelt nicht nur gesetzeskonform, sondern auch im Sinne von Inklusion, Gerechtigkeit und Fortschritt. Oder kurz gesagt: Digitale Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht – und unsere gemeinsame Verantwortung.