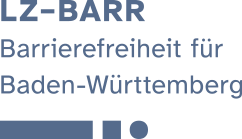Digitale Barrierefreiheit: Mehr als nur ein technisches Versprechen
In der heutigen digitalen Welt ist Barrierefreiheit ein zentrales Thema. Begriffe wie "BITV-konform", "BFSG-konform" oder allgemein "barrierefrei" werden häufig in der Werbung verwendet. Doch was bedeuten diese Aussagen wirklich? Und welche Verantwortung tragen sowohl Dienstleister als auch Auftraggeber und Online-Redaktionen bei der Umsetzung?
Gesetzliche Grundlagen und technische Standards
In Deutschland definieren Gesetze wie das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) die Anforderungen an digitale Barrierefreiheit. Auf europäischer Ebene setzt die Norm EN 301549 technische Standards, die klare Vorgaben machen und wenig Interpretationsspielraum lassen. Diese Norm basiert auf den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) und legt fest, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit digitale Angebote als barrierefrei gelten. Dabei handelt es sich im Übrigen bereits um Mindeststandards und nicht maximale Barrierefreiheit.
Barrierefreiheit: Mehr als nur Technik
Digitale Barrierefreiheit beschränkt sich nicht allein auf technische Aspekte – und kann schon gar nicht durch sogenannte Accessibility-Overlays hergestellt werden. Auch das Design, das unter anderem auf eine ausreichende Kontrastgestaltung, gut lesbare Schriftgrößen und eine durchdachte und konsistente Benutzerführung setzt, spielt eine wichtige Rolle. Zudem müssen Inhalte klar strukturiert und logisch gegliedert sein, damit sie für alle Nutzer zugänglich sind. Neben der technischen Umsetzung und dem Design spielen aber auch redaktionelle Faktoren eine zentrale Rolle. Bilder müssen mit sinnvollen Alternativtexten versehen werden, damit sie auch für Screenreader-Nutzer verständlich sind. Videos benötigen Untertitel und oft auch Transkriptionen, um auch Menschen mit Hörbehinderungen die Inhalte zugänglich zu machen. Ebenso sind häufig Audiodeskriptionen notwendig, um rein visuelle Informationen innerhalb von Videos für blinde oder sehbehinderte Nutzer zu beschreiben. Und das sind nur einige Beispiele, die die Online-Redaktion betreffen. Ohne gut geschulte Mitarbeitende, die für die redaktionelle Betreuung von Websites, Apps oder Online-Shops verantwortlich sind, kann Barrierefreiheit nicht umfassend und vor allem nicht nachhaltig gewährleistet werden.
Die Rolle von Accessibility-Overlays
Einige Anbieter werben mit sogenannten Accessibility-Overlays oder Plugins, die versprechen, Websites automatisch barrierefrei zu machen. Diese Lösungen sind jedoch mehr als umstritten – die Überwachungsstellen in Deutschland haben dazu ganz klar Position bezogen und raten als Lösung für Barrierefreieheit im Sinne einer gesetzlichen Konformität klar von Accessibility-Overlays ab. Alle Experten weisen seit Jahren darauf hin, dass solche Tools oft nur oberflächliche Anpassungen vornehmen und grundlegende Barrieren nicht beseitigen. Zudem können sie bestehende Assistenztechnologien beeinträchtigen und somit das Nutzererlebnis verschlechtern. Das gilt auch für all die neuen Anbieter, die auf Künstliche Intelligenz, also KI setzen. Es gibt kein einziges Tool, das Barrierefreiheit herstellen kann.
Gemeinsame Verantwortung für Barrierefreiheit
Auch die Aussage, eine Agentur könne eine vollständig barrierefreie Website liefern, greift zu kurz. Während Dienstleister die technische und gestalterische Grundlage schaffen können, liegt die kontinuierliche Pflege und Aktualisierung in der Verantwortung der Website-Betreiber und Betreiberinnen. Websites sind dynamische Systeme, die regelmäßig aktualisiert werden. Jedes neue Plugin, jede Designänderung jeder neue Inhalt kann neue Barrieren schaffen. Daher ist es essenziell, dass interne Teams die Prinzipien der Barrierefreiheit verstehen und anwenden.
Barrierefreiheit als fortlaufender Prozess
Barrierefreiheit ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Regelmäßige Überprüfungen, ggf. Tests mit Nutzern und Anpassungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass digitale Angebote für alle zugänglich bleiben. Es reicht nicht aus, von "barrierearmen" Lösungen zu sprechen, da die gesetzlichen Anforderungen bereits Mindeststandards darstellen. Auftraggebende sollten daher proaktiv handeln und Barrierefreiheit als integralen Bestandteil ihrer digitalen Strategie betrachten. Auftraggebende müssen entweder eigene Kompetenzen in Digitaler Barrierefreiheit aufbauen oder Experten und Expertinnen hinzuziehen. Das gilt auch und insbesondere im Rahmen von Ausschreibungen bzw. der Beschaffung.
Fazit
Werbung mit Begriffen wie "BITV-konform" oder "barrierefrei" verpflichtet zu klar definierten Leistungsversprechen, die von Auftragnehmenden geprüft und abgenommen werden muss, ggf. mithilfe eines externen Accessibility-Consultants. Treu und Glaube ist hier fehl am Platz. Wer Barrierefreiheit verkauft, muss das auch nachweisen können und ggf. nachbessern, bis das zugesagte Leistungsversprechen erreicht wurde. Digitale Barrierefreiheit erfordert ein Zusammenspiel von Technik, Design und redaktioneller Arbeit. Sowohl Dienstleister als auch Behörden und Unternehmen tragen Verantwortung für die Umsetzung und kontinuierliche Pflege barrierefreier Angebote. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann echte Inklusion im digitalen Raum erreicht werden.