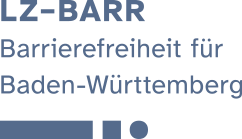The WebAIM Million Project
Seit einigen Jahren verfolge ich die Ergebnisse des Projekts „The WebAIM Million“, das jedes Jahr automatisiert die Barrierefreiheit der Startseiten der weltweit meistbesuchten Websites überprüft. Ich habe mir immer mal wieder vorgenommen, einen kurzen Artikel darüber zu schreiben. 2025 habe ich es jetzt endlich geschafft. Seit 2019 analysiert WebAIM (Web Accessibility In Mind) mit seinem bekannten WAVE-Tool über eine Million Webseiten, um eine Bestandsaufnahem zu machen, wie barrierefrei Webseiten heutzutage sind, ob es Fortschritte gibt und was die häufigsten Fehler sind – wovon es nach wie vor mehr als genug gibt.
Kurzübersicht Entwicklung seit 2019
Die aktuelle Auswertung aus 2025 zeigt, dass die durchschnittliche Fehleranzahl pro Seite auf 51 gesunken ist. Das ist eine Verbesserung von gut 10 % gegenüber 2024, wo es noch 56,8 Fehler pro Seite waren. Klingt erstmal gut, oder? Aber in absoluten Zahlen wurden insgesamt immer noch über 50 Millionen Fehler festgestellt. Fast 95 % aller untersuchten Seiten verstoßen gegen die WCAG 2 – auch wenn dieser Wert immerhin leicht unter dem Vorjahreswert von 95,9 % liegt.
Und während die Fehlerquote gesunken ist, sind die Webseiten gleichzeitig komplexer geworden. Die durchschnittliche Anzahl der Elemente pro Startseite ist von 1.173 im Jahr 2024 auf 1.257 im Jahr 2025 gestiegen. Damit ist klar: Die Webseiten werden nicht nur nicht barrierefreier, sie werden auch immer komplizierter und fehleranfälliger. Die häufigsten Fehler bleiben seit Jahren fast unverändert:
- Zu geringer Kontrast (79,1 % der Seiten)
- Fehlende Alternativtexte für Bilder (55,5 %)
- Fehlende Beschriftungen bei Formularelementen (48,2 %)
- Leere Links (45,4 %)
- Leere Buttons (29,6 %)
- Fehlende Dokumentensprache (15,8 %)
Diese Zahlen ändern sich zwar leicht von Jahr zu Jahr, aber wirklich besser wird es nicht. Vor allem Bilder ohne Alternativtexte und schlecht lesbare Schriftfarben auf kontrastarmen Hintergründen scheinen ein Dauerbrenner zu sein.
Wenn man sich den langfristigen Verlauf seit 2019 ansieht, ist immerhin ein gewisser Fortschritt zu erkennen. Damals lag die durchschnittliche Fehleranzahl pro Seite noch bei etwa 60, jetzt bei 51. Auch der Anteil der Seiten mit WCAG-Verstößen ist von 97,8 % im Jahr 2019 auf 94,8 % im Jahr 2025 gesunken. Das sind zwar kleine Fortschritte, aber gemessen an der enormen Komplexität moderner Webseiten, die in diesem Zeitraum von durchschnittlich 782 auf 1.257 Elemente pro Seite gestiegen ist, könnte es schlimmer aussehen.
WebAIM Million Projects – begrenzte Aussagekraft
Die Ergebnisse des WebAIM Million Projects liefern wertvolle Einblicke, aber sie haben auch ihre Grenzen. Automatisierte Tests wie der von WebAIM decken zwar Millionen von Fehlern auf, sind aber gleichzeitig auch anfällig für Fehlalarme. Diese sogenannten „false positives“ entstehen, wenn das Tool einen Fehler meldet, der bei genauerem Hinsehen gar keiner ist. Gerade bei komplexen Webseiten kann es passieren, dass ein Tool bestimmte Strukturen nicht richtig interpretiert oder alternative Mechanismen übersieht, die durchaus barrierefrei sind.
Viel schwerwiegender ist aber, dass nur ein Bruchteil der Barrierefreiheitsanforderungen überhaupt automatisiert überprüfbar ist. Automatisierte Tests können zum Beispiel feststellen, ob ein Bild ein Alt-Attribut hat, aber nicht, ob dieser Alternativtext sinnvoll ist oder ob das Bild überhaupt einen Alternativtext bekommen sollte (das ist durchaus Möglichkeit). Auch Kontextfragen, die korrekte Verwendung von semantischem HTML, Darstellungsfehler bei benutzerdefinierten Anpassungen von Texten und Farben, die Verständlichkeit von Überschriften, Labels und Fehlermeldungen oder eine konsistente Navigation innerhalb einer Webseite lassen sich kaum automatisiert erfassen (um mal nur ein paar Beispiele zu nennen).
Das bedeutet, dass das Ergebnis des WebAIM Million Projects mit Sicherheit seit jeher noch zu optimistisch ausfällt. Eine manuelle Überprüfung würde erfahrungsgemäß weitaus mehr Fehler aufdecken, als es ein automatisiertes Tool jemals könnte. Viele Aspekte der Barrierefreiheit sind schlichtweg zu komplex, um maschinell erkannt zu werden. Insbesondere für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder für Nutzer, die spezielle Interaktionsformen wie Screenreader oder Sprachsteuerung verwenden, liegen hier große Herausforderungen, die im Rahmen automatisierter Tests meist unsichtbar bleiben.
Dieser Punkt wird oft unterschätzt, wenn man sich nur die nackten Zahlen wie die vom WebAIM Million Project ansieht. Tatsächlich sind automatisierte Tests ein guter Indikator für technische Probleme, aber sie sind keinesfalls ein vollständiges Bild der Realität. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der Anteil der wirklich barrierefreien Webseiten sogar noch deutlich geringer sein dürfte als die ohnehin schon ernüchternden Zahlen vermuten lassen.
Fazit:
Aus kommunikativer Sicht ist das „The WebAIM Million“ sicherlich eine gute Sache. Das Projekt liefert jedes Jahr interessante Zahlen und im Verhältnis zum deutlich gestiegenen Komplexitätsgrad von Webseiten und Webanwendungen scheint es nominell etwas aufwärtszugehen. Doch am Ende bleibt die Erkenntnis, dass trotz aller Bemühungen die großen Baustellen seit Jahren dieselben sind. Das zeigen auch andere Untersuchung, wie die kürzlich aktualisierte Studie zur Barrierefreiheit von Online-Shops oder der Zweite Überwachungsbericht zur Barrierefreiheit Öffentlicher Websites. Und das Projekt „The WebAIM Million“ ist mit Sicherheit aussagekräftiger als das Nonsens-Projekt Atlas digitale Barrierefreiheit, das ich hier noch nichtmal verlinken möchte.