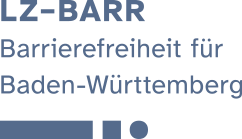BFSG und Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr
Seit dem 28. Juni 2025 ist in Deutschland das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) vollständig in Kraft. Das Gesetz nimmt viele privatwirtschaftliche Unternehmen in die Pflicht – insbesondere solche Unternehmen, die digitale Dienstleistungen für Verbraucher bereitstellen. Oft hört man in diesem Kontext den Begriff „Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr“. Aber was genau bedeutet „Dienstleistung im elektronischen Geschäftsverkehr“ und was fällt alles unter diesen Begriff? Dass ein Online-Shop darunterfällt, ist klar. Aber was ist, wenn der Shop nur kostenlose Produktproben anbietet? Was ist, wenn ein Arzt online eine verbindliche Terminvereinbarung anbietet? Greift dann das BFSG? Mit solchen Fragen befasst sich der folgende Beitrag. Denn was sich hinter dem Begriff „Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr“ im Kontext des BFSG verbirgt, erschließt sich nicht immer sofort.
Disclaimer: der nachfolgende Text ist keine und ersetzt keine Rechtsberatung.
Was meint das BFSG mit digitaler Dienstleistung?
Das BFSG adressiert Unternehmen, die Dienstleistungen im sogenannten elektronischen Geschäftsverkehr anbieten. Zum elektronischen Geschäftsverkehr zählen Online-Plattformen und Websites, über die Verbraucher digitale Verträge abschließen können. Gemeint sind nicht nur klassische Online-Shops (Stichwort: e-Commerce), sondern auch Portale, bei denen Dienstleistungen angeboten, vermittelt oder gebucht werden. Dabei ist nicht entscheidend, ob die Dienstleistung kostenpflichtig ist, also bezahlt wird. Entscheidend ist, ob am Ende ein Vertrag mit einem Verbraucher geschlossen wird – sei es kostenpflichtig oder auch im Rahmen eines kostenlosen Modells mit Werbeeinblendungen oder Datenweitergabe. Ist das gegeben, fällt die Dienstleistungen unter das BFSG.
Beispiele für Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr:
- Immobilienportale zur Anbahnung von Miet- oder Kaufverträgen
- Versicherungsplattformen, auf denen Policen abgeschlossen werden können
- Buchungsportale für Dienstleistungen wie Handwerker, Reinigungsdienste oder Transport
- Vergleichsplattformen mit direkter Wechselmöglichkeit (z. B. Energieanbieter, Mobilfunkverträge)
- Streamingdienste mit Abo-Modellen
- Plattformen für Webinare, Online-Coachings oder andere digitale Veranstaltungen
- Anbieter von SaaS-Lösungen für Verbraucher
Wo beginnt die Verpflichtung zur Barrierefreiheit?
Die Barrierefreiheitspflicht bezieht sich auf den digitalen Prozess, der für den Abschluss eines Verbrauchervertrags durchlaufen werden muss. Der gesamte Prozess muss so gestaltet sein, dass ihn auch Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen ohne fremde Hilfe abschließen können. Dabei geht es um den gesamten Prozess, von der Vertragsanbahnung bis zum letztendlichen Abschluss eines Vertrags – inklusive aller zur Entscheidungsfindung, zum Verständnis und zum Widerruf relevanten Dokumente. Wo der genaue Einstiegspunkt für diesen Prozess liegt, kann dabei von Fall zu Fall durchaus unterschiedliche sein. Die eigentliche Dienstleistung selbst muss nicht barrierefrei sein – es sei denn, es handelt sich um gesetzlich geregelte Fälle, wie zum Beispiel Bankdienstleistungen. Diese Fälle sind allerdings im BFSG aufgelistet (Dienstleistungen, die dort nicht genannt werden, fallen auch nicht unter das BFSG).
Wichtig: wie und in welchem Umfang die Barrierefreiheit von Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr hergestellt werden soll, steht übrigens nicht im BFSG. Die konkreten Umsetzungsrichtlinien finden sich in verschiedenen Kapiteln der harmonisierten EU Norm EN 301 5499 (jeweils aktueller Stand), die in den relevanten Kapiteln in weiten Teilen auf die jeweils gültigen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verweisen.
Enthält das BFSG Ausnahmen?
Ja es gibt Ausnahmen, aber nur wenige. Dass Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und unter zwei Millionen Euro Jahresumsatz nicht unter das BFSG fallen bzw. die Anforderungen nicht umsetzen müssen, ist sicherlich mittlerweile bekannt. Es kann theoretisch aber auch eine Ausnahme geltend gemacht werden, wenn die Umsetzung der Barrierefreiheit die Dienstleistung fundamental verändern oder eine unverhältnismäßige Belastung für das Unternehmen bedeuten würde. Beides muss allerdings sauber dokumentiert und bei der Marktüberwachungsbehörde angezeigt werden. Dieses Vorgehen sollte man aber besser durch einen Fachanwalt begleiten lassen und das Für und Wider gegeneinander abwägen.
Da aber reine Informationsangebote, einfache Kontaktformulare oder zum Beispiel Newsletter-Anmeldungen ohne konkreten Vertragsschluss in der Regel nicht unter das BFSG fallen und die Verpflichtung im Prinzip nach Vertragsabschluss endet, bestehen ja bereits auch so schon eine ganze Menge Ausnahmen. Leider ist das BFSG diesbezüglich teilweise unkonkret und in der Praxis ergeben sich im Detail immer wieder Fragen, die am Ende ein Fachanwalt klären muss.
Was passiert bei Verstößen?
Wie scharf die Klinge der Marktüberwachung in Zukunft sein wird, muss sich zeigen. Grundsätzlich aber soll die Einhaltung des BFSG von der neu geschaffenen Marktüberwachungsstelle der Länder kontrolliert werden. Bei Verstößen wird ein Unternehmen zunächst durch die Marktüberwachungsstelle zur Nachbesserung aufgefordert. Erst wenn keine Reaktion bzw. Anpassung erfolgt, kann die Dienstleistung untersagt und ein Bußgeld verhängt werden – in schwerwiegenden Fällen bis zu 100.000 Euro. Letztendlich droht aber eine „Überwachung“ nicht nur durch die Marktüberwachungsstellen. Da es sich bei dem BFSG um ein Verbraucherschutzgesetz handelt, können sich auch Verbraucherinnen und Verbraucher (oder anerkannte Verbände) bei Unternehmen über Barrieren beschweren. Und da die Anforderungen des BFSG sogenannte Marktverhaltensvorschriften sind, können auch Wettbewerber im Rahmen des UWG gegen Verstöße rechtlich vorgehen. Ungemach droht also im Zweifelsfall von verschiedenen Seiten, sodass man es Zweifelsfall besser nicht drauf ankommen lassen sollte.