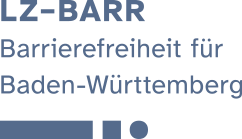Schritt für Schritt zur Umsetzung des BFSG
Seit dem 28. Juni 2025 müssen viele Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen barrierefrei anbieten. Auch wenn der Gesetzgeber Übergangsfristen vorgesehen hatte, sind viele Unternehmen immer noch überfordert. Wo soll man anfangen, was muss barrierefrei sein und was nicht? Am Anfang stehen Unternehmen vor vielen Fragen. Damit die Umsetzung des BFSG nachhaltig gelingen kann, sollte man das Ganze strukturiert angehen – am besten mit einer Schritt-für-Schritt Anleitung zur Umsetzung des BFSG. Die nachfolgenden 10 Schritte sollten Unternehmen und Dienstleistern bei der Umsetzung des BFSG helfen.
10 Schritte zur Umsetzung des BFSG
1. Bestandsaufnahme
Bevor man etwas verbessern kann, muss man wissen, wo die Barrieren liegen. Webseiten, Apps, PDFs, Self-Service-Angebote und Supportkanäle müssen zunächst in Bezug auf die gesetzlichen Verpflichtungen hin kategorisierte werden. Was unter das BFSG fällt, muss auditiert werden. Vorhandene Barrieren müssen identifiziert, klassifiziert und Gewerken (zur Behebung) zugeordnet werden.
2. Recht klären
Die Umsetzung des BFSG hat mit Verbraucherrechten und Wettbewerbsrecht zu tun. Eine juristische Begleitung ist hier genauso wichtig, wie bei der Umsetzung der DSGVO. Ohne juristische Grundlage drohen ggf. teure Fehlentscheidungen. Übergangsfristen, Dokumentationspflichten und die Frage, ob ein CE-Kennzeichen oder eine Konformitätserklärung notwendig ist, müssen von Beginn an geklärt werden. Das Gleiche gilt für die Frage, was überhaupt im Rahmen des BFSG umgesetzt werden muss.
3. Verantwortlichkeiten & Fahrplan
Barrierefreiheit kann man nicht nachträglich anflanschen – dazu sind zu viele Stakeholder involviert. Es braucht klare Zuständigkeiten in Produktmanagement, IT, UX, Redaktion, Recht und Support. Ein realistischer Fahrplan mit Meilensteinen sorgt dafür, dass niemand den Überblick verliert. Und letztendlich braucht es auch einen Barrierefreiheitsbeauftragten als zentrale Anlaufstelle.
4. Grundlagen analysieren und definieren
Gerade in großen Unternehmen stehen Parameter wie Corporate-Design und ganze Design-Komponenten auf Basis von Pattern-Libraries meist schon fest und sind integraler Bestandteil der gesamten Außendarstellung. Wenn Barrierefreiheit dort nicht bereits integrierte ist, wird das im digitalen Alltag schnell zum Problem. Deshalb müssen Farbkontraste, Schriften, Layouts und Komponenten ggf. kontrolliert und an Anforderungen der Barrierefreiheit angepasst werden.
5. Schulung & Enablement
In den meisten Fällen ist Know-how im Bereich der Barrierefreiheit in Unternehmen noch nicht vorhanden. Barrierefreiheit lebt aber vom Verständnis aller Beteiligten. Daher benötigen Teams praxisnahe Schulungen und Möglichkeiten eines Teamübergreifenden Austausches. Der Aufbau eines internen Accessibility-Teams mit einem Barrierefreiheitsbeauftragten als zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeiter ist langfristig die beste Lösung, um Barrierefreiheit nachhaltig zu etablieren.
6. Umsetzung
Das BFSG betrifft niemanden, der ein Unternehmen oder eine Dienstleistung neu an den Start bringt. Insofern betrifft es immer Unternehmen, die bereits am Markt tätig sind und viele Kommunikationskanäle bedienen. Nach der Bestandsaufnahem und der rechtlichen Abklärung geht es an die tatsächliche Umsetzung. Dazu bedarf es entweder spezialisierter Dienstleister, die zum Beispiel Accessibility-Audits durchführen und den Prozess beratend und operativ begleiten oder eine ggf. vorhandene Inhouse-Abteilung muss entsprechend befähigt werden, digitale Barrierefreiheit umzusetzen (Stichwort: Schulung). Das betrifft alle beteiligten Gewerke, wie IT, UX und Redaktion. Aber auch Drittanbieter müssen auf den Prüfstand und können zukünftig nur einbezogen werden, wenn sie nachweislich Standards einhalten (Stichwort: Ausschreibung, Beschaffung).
7. Test & Nachweis
Digitale Barrierefreiheit ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein fortlaufender Prozess. Deshalb ist eine langfristige Strategie der Qualitätssicherung und Selbstkontrolle wichtig. Automatisierte Prüfungen können dabei im Alltag helfen und decken vor allem Flüchtigkeitsfehler auf. Sie ersetzen aber keine Tests mit Menschen und assistiven Technologien. Regelmäßige Zwischen-Audits und einfache Smoke-Tests sind also genauso wichtig, wie Tests mit echten Nutzerinnen und Nutzern, damit Sie Barrierefreiheit auch stichhaltig nachweisen können.
8. Konformitätsbewertung & Erklärung
Das BFSG fordert nicht nur Barrierefreiheit, sondern auch deren Nachweis. Für Produkte heißt das in Kurzform: Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichnung und eine Konformitätserklärung. Im digitalen Bereich ist der Schritt nicht weniger umfangreich: Anbieter von Online-Shops, Banking-Apps, Vergleichs- und Bewertungsportalen oder anderen Dienstleistungen müssen eine sogenannte Barrierefreiheitserklärung bereitstellen. Diese Erklärung dient als Informationsgrundlage für Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso, wie für die Marktüberwachungsbehörden. Die Barrierefreiheitserklärung sollte aber nicht ohne juristischen Beistand verfasst werden.
9. Technische Dokumentation
Alles, was entwickelt und geprüft wurde, muss nachvollziehbar festgehalten sein. Die technische Dokumentation ist gesetzlich verpflichtend, um zu belegen, dass Produkte oder Dienstleistungen die Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen. Sie enthält die Beschreibung des Angebots, die angewandten Normen sowie die Begründung, wie Barrierefreiheit umgesetzt wurde. Nach dem „Inverkehrbringen“ (so heißt das im Juristendeutsch) ist technische Dokumentation mindestens fünf Jahre aufzubewahren und regelmäßig zu aktualisieren, damit Änderungen an Produkten, Standards oder Prozessen nachvollziehbar dokumentiert bleiben. So dient sie nicht nur der Marktaufsicht als Nachweis, sondern auch intern als Grundlage für Qualitätssicherung und Weiterentwicklung.
10. Betrieb & Monitoring
Barrierefreiheit ist ein laufender Prozess. Digitale Angebote müssen regelmäßig überprüft werden – bei jedem Relaunch, jedem Update und jedem größeren Content-Release. Dazu gehört die Einbindung von Nutzerfeedback, die wiederholte Schulung von Mitarbeitenden sowie Experten-Audits und Tests mit assistiven Technologien. Auch Monitoring-Prozesse, z. B. stichprobenartige Prüfungen von PDFs oder automatisierte Tests im Deployment, sind sinnvoll. Nur so bleibt Barrierefreiheit dauerhaft Teil der Produktentwicklung und passt sich an neue Inhalte und Technologie